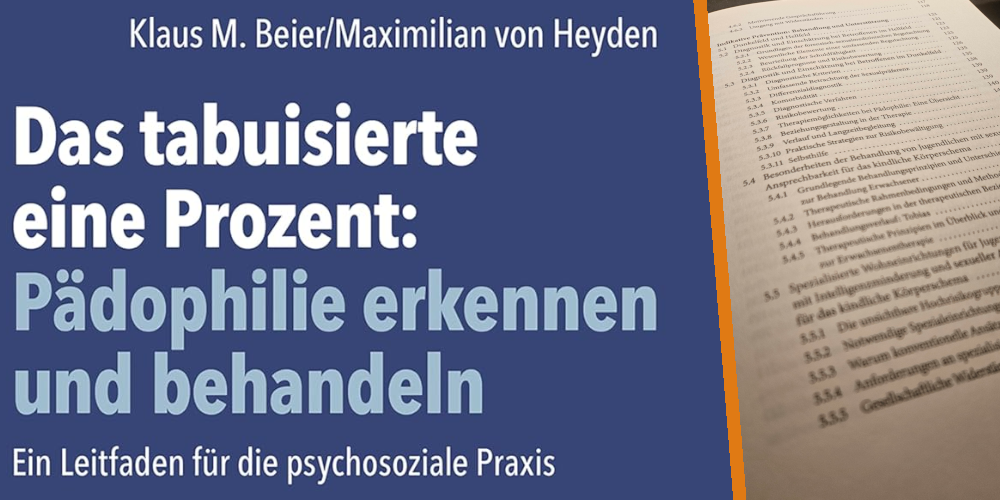Es ist wohl keine Übertreibung zu sagen, dass Hilfsangebote für pädophile Menschen rar gesät sind. In der Ausbildung von Therapeuten und Fachkräften der sozialen Arbeit spielt das Thema Pädophilie nur selten eine Rolle. Das führt dazu, dass Pädophile, die sich von Therapieprojekten wie Kein Täter Werden nicht angesprochen fühlen und anderswo Hilfe suchen oft auf überforderte Fachkräfte stoßen, die sich unsicher fühlen und nicht das notwendige Wissen haben, um eine professionelle Hilfe anzubieten. Um diese Wissenslücke aufzufüllen, gucken manche Fachkräfte vielleicht in der Fachliteratur nach. Genau diese Zielgruppe möchte das Anfang September von Prof. Klaus Beier und Maximilian von Heyden veröffentlichte Fachbuch mit dem Titel „Das tabuisierte eine Prozent: Pädophilie erkennen und behandeln. Ein Leitfaden für die psychosoziale Praxis“ füllen. Da die dort stehenden Inhalte somit auch beeinflussen sollen, welche Einstellungen Fachkräfte gegenüber Hilfe suchenden Pädophilen haben, und wie sie diese behandeln sollen, habe ich mir das Werk ebenfalls besorgt und mich durch das Buch durch gearbeitet.
Dabei lässt der Titel, der einmal unmögliches verspricht (Pädophilie zu erkennen ist – glücklicherweise – immer noch nicht zuverlässig möglich) und impliziert, dass jede:r Pädophile therapeutische Behandlung braucht, schon nichts Gutes ahnen. Jede Resthoffnung, dass das Buch vielleicht doch noch einen positiven Beitrag zur Thematik leisten könnte, verflogen dann bereits mit den allerersten Sätzen aus dem Grußwort der ehemaligen Bundesministerin Brigitte Zypries, die wie folgt lauten:
Als Fachkraft in Therapie und Beratung stehen Sie immer wieder vor einer der herausforderndsten Aufgaben im psychosozialen Bereich: dem professionellen Umgang mit möglichen Gefährdungen von Kindern durch sexuellen Missbrauch oder gar mit bereits erfolgtem Missbrauch und seinen Folgen. Der Missbrauch kann ausgehen von Menschen, die eine sexuelle Ausrichtung auf das kindliche Körperschema aufweisen. Dies wird als Pädophilie bezeichnet. Wir haben viel zu lange außer Acht gelassen, dass es sich bei der Pädophilie – gemäß der Weltgesundheitsorganisation – um eine psychische Störung handelt, die mit einer Fremdgefährdung einhergehen kann.
Pädophile werden eingeführt als mögliche Gefahr und psychisch gestörte potenzielle Täter. Stigmatisierender hätte man so ein Buch wohl kaum anfangen können. In diesen ersten vier Sätzen wird schon der Grundton gesetzt für die nächsten 211 Seiten. Nach Lesen des Buches bin ich mit einem Haufen Notizen und viel Wut im Bauch zurückgeblieben und einer gewissen Ratlosigkeit, was ich damit nun machen soll.
Ich habe mich am Ende für eine Beitragsserie aus drei Teilen entschieden. Teil 1, das ist dieser hier, enthält dabei eine reine Inhaltszusammenfassung der einzelnen Kapitel, wobei ich mich bemüht habe, diese Zusammenfassungen so neutral wie mir nur möglich zu verfassen. Inhaltliche Kritik insbesondere der in dem Buch getätigten Aussagen und Narrativen, die ich für problematisch oder unethisch halte, wird den zweiten Teil ausmachen, der demnächst erscheinen wird. Der dritte Teil wird aus einem Faktencheck bestehen, denn soviel kann ich schon einmal verraten: Viele Aussagen aus dem Buch sind schlichtweg falsch, lassen sich nicht belegen, oder widersprechen sogar konkret an anderen Stellen im Buch getätigten Aussagen.
Kapitel 1: Einführung und Grundlagen
Die Autoren beginnen mit Erklärungen zu einigen Grundlagen zu Sexualität und sexuellen Präferenzen. Dabei wird zunächst die Wichtigkeit intimer (sexueller) Beziehungen zu anderen Menschen für die Gesundheit betont. Weiter beschreiben die Autoren ein 2004 von Beier und Kollegen entwickeltes Modell sexueller Präferenz, nach der diese sich auf drei Achsen beschreiben lasse: Geschlecht, Alter und Art der Interaktion. Die individuelle Präferenz manifestiere sich dabei auf den Ebenen Fantasie, Verhalten und Selbstkonzept, werde im Jugendalter ausgeprägt und bleibe danach ein Leben lang stabil. Weiter wird die Klassifizierung von Paraphilien in den medizinischen Handbüchern ICD-10, ICD-11 und DSM-V beschrieben und der Unterschied zwischen Paraphilien und paraphilen Störungen erklärt. Anders als Zypries im Grußwort sehen die Autoren Pädophilie also nicht grundsätzlich als Störung, sondern nur bei Leidensdruck oder Fremdgefährdung. Danach gehen die Autoren unter der Überschrift „Störungsmodelle“ auf vermutete Ursachen für die Entwicklung sexueller Präferenzen ein und stellen das biopsychosoziale Verursachermodell vor. Laut diesem Modell entstehen sexuelle Präferenzen aus einer Kombination von „angeborene[r] Vulnerabilität“ und „ungünstige[n] psychosozialen Erfahrungen“.
Nach den eher allgemeinen Ausführungen, die sich auf Sexualität und Paraphilien im Allgemeinen beziehen, geht es schließlich spezifisch um Pädophilie (im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch). Diese wird zunächst definiert als „eine anhaltende sexuelle Präferenz, bei der die sexuelle Erregbarkeit und das sexuelle Interesse primär auf das kindliche, vorpubertäre Körperschema gerichtet sind“, was anhand der Tanner-Stadien illustriert wird. Pädophilie wird schließlich vom Begriff sexueller Kindesmissbrauch abgegrenzt, wobei den Autoren zufolge 50–60 % der männlichen Missbrauchstäter nicht pädophil seien. Dennoch bestehe ein „klarer Zusammenhang“ zwischen Pädophilie und Kindesmissbrauch, was daran festgemacht wird, dass die Rückfallquoten unter pädophilen Straftätern im Vergleich zu Tätern, die nicht als pädophil eingestuft werden, erhöht seien.
Zuletzt gehen die Autoren auf grundlegende Aspekte der therapeutischen Arbeit mit Pädophilen ein. Diese bestehe „auf der Entwicklung von Strategien zur Verhaltenskontrolle und der Minderung des Leidensdrucks“ und befände sich grundsätzlich „im Spannungsfeld zwischen therapeutischer Vertraulichkeit und aktivem Kinderschutz“. Die Beschreibungen der Autoren beschäftigen sich entsprechend vor allem mit dem Umgang mit „Situationen von unmittelbarem Risiko“, es werden mögliche Interventionen „je nach Gefährdungsgrad“ vorgestellt und beschrieben, ab wann ein Bruch der therapeutischen Schweigepflicht gerechtfertigt wäre. Ebenso solle Therapieteilnehmenden vor Therapiebeginn immer vermittelt werden, dass „der Schutz gefährdeter Kinder eine hohe Priorität hat.“ Ethische Fragestellungen werden nur im Kontext der „Verantwortung gegenüber möglichen Opfern“ diskutiert. Darauf, wie Leidensdruck oder Belastungen aufgrund von Stigmatisierung reduziert werden können, wird wiederum überhaupt nicht eingegangen.
Kapitel 2: Das »eine Prozent« verstehen
Im zweiten Kapitel geht es spezifischer um Grundlagen zur Pädophilie. Zunächst gehen die Autoren auf die Frage ein, wie hoch der Anteil Pädophiler an der männlichen Gesamtbevölkerung ist, und kommen auf eine Schätzung von etwa 1 %, woraus sich auch der Titel des Buches ableitet. Anschließend grenzen die Autoren erneut Pädophilie von Kindesmissbrauch ab, nicht ohne dabei gleichzeitig noch einmal „die Bedeutung der sexuellen Präferenz als Risikofaktor“ zu betonen.
Weiterhin wird das im vorigen Kapitel bereits erwähnte biopsychosoziale Entstehungsmodell sexueller Präferenzen konkret auf die Pädophilie bezogen näher beschrieben. Als biologische Faktoren wird eine abweichende Gehirnstruktur, Störungen im Hormonsystem und eine mögliche genetische Komponente diskutiert. Als psychologische Faktoren werden mehrere Hypothesen in Erwägung gezogen: die Konditionierungstheorie, laut der Pädophilie durch wiederholtes Erleben sexueller Erregung in Verbindung mit Kindern verfestigt wird; Bems Theorie, laut der Pädophilie entsteht, wenn ein Betroffener in seiner Kindheit dysfunktionale Beziehungen zu Gleichaltrigen hatte; und die Theorie, nach der Missbrauchserfahrungen eher dazu führen, dass jemand zum Täter wird. Letztere wird von den Autoren aber eher abgelehnt, da sie stigmatisierend gegenüber Missbrauchsopfern sei und sich aus einem Täterverhalten nicht zwingend die Sexualpräferenz ableiten lasse. Als soziale Faktoren wird zuletzt in Erwägung gezogen, dass „unsichere Bindungsmuster“ und „mangelnde soziale Kompetenzen“ dazu führen, dass Erwachsene aus Angst vor anderen Erwachsenen sich lieber Kindern zuwenden.
Im gesamten Buch wird Pädophilie überwiegend bei Männern besprochen, da es sich den Autoren zufolge um eine „primär männliche Domäne“ handelt. Dies wird vor allem daran festgemacht, dass sich beim Präventionsnetzwerk Kein Täter Werden bis 2022 lediglich drei (nicht-exklusiv) pädophile Frauen gemeldet hätten, und die meisten Täter im Hellfeld Männer seien. Weibliche Pädophilie wird lediglich einmal im Zusammenhang der „Beteiligung von Frauen an Kindesmissbrauch“ erwähnt, wobei laut den Autoren die meisten Frauen nicht aus einer „primären sexuellen Motivation“, sondern unter dem Einfluss eines (männlichen) Partners handeln würden. Dies wird als weiterer Beweis gewertet, dass „genuine“ Pädophilie bei Frauen im Grunde nicht vorkommen würde.
Am Ende des Kapitels gehen die Autoren schließlich auf strafrechtliche Aspekte ein. Dazu wird ein Überblick der gesetzlichen Lage im Bereich Kindesmissbrauch und Kinderpornografie gegeben, zu jedem entsprechenden Paragrafen konkrete Handlungsempfehlungen für Fachpersonal bei Tatverdacht gegeben und aufgelistet, welcher Personenkreis damit geschützt werden soll (beim § 184l (Inverkehrbringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild) schreiben die Autoren dazu: „Geschützt wird die Menschenwürde von Kindern (< 14) – Puppen mit diesem Erscheinungsbild [sic!]“). Gesetzesverschärfungen aus den letzten Jahren werden positiv bewertet, da dadurch Prävention und Repression gestärkt werde, und insgesamt die gesetzliche Lage in Deutschland als „umfassend und differenziert“ gelobt. Zum Schluss geht es um „ethische Aspekte“, die sich vor allem darauf beschränken, inwiefern zum Beispiel die therapeutische Schweigepflicht bei Pädophilen im Konflikt zum Kinderschutz steht. Hierbei wird auch die Kriminalisierung und Stigmatisierung pädophiler Menschen problematisiert, da sie dazu führe, dass Pädophile eher nicht in Therapie gehen und dadurch die Prävention erschwert werde.
Kapitel 3: Universelle Prävention: Gesellschaftliche Grundlagen
Kern des Buches ist die Beschreibung von drei Formen von Prävention für Kindesmissbrauch, die auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Zunächst wird dabei die universelle Prävention beschrieben, die alle Maßnahmen umfasse, „die an Personengruppen oder die Gesamtbevölkerung gerichtet sind und darauf abzielen, die Ausbildung einer pädophilen Störung zu verhindern.“ Diese bearbeite vor allem die Stigmatisierung der Pädophilie, deren Kern den Autoren zufolge aus der „zentralen Fehlwahrnehmung“ bestehe, Pädophilie und Missbrauch gleichzusetzen, aber auch daraus, dass Pädophilie als gefährlich und unkontrollierbar wahrgenommen werden. Dies führe bei vielen Menschen beim Gedanken an Pädophile zu Emotionen wie Wut und Angst und ultimativ zu gesellschaftlicher Ausgrenzung. Diese Stigmatisierung habe auch negative Auswirkungen auf Pädophile selber, insbesondere in Form hoher psychischer Belastung und erhöhter Suizidalität sowie sozialer Isolation. Darüber hinaus könne das Stigma dazu führen, dass „Menschen mit Pädophilie keine Hilfe suchen“ und dadurch das Risiko für Missbrauch steige. Um das Stigma zu bekämpfen, sei vor allem die humanisierende Darstellung nicht übergriffig gewordener Pädophiler besonders effektiv.
Im Anschluss wird Antistigmaarbeit als Maßnahme der universellen Prävention nur noch zu dem Zweck beschrieben, das „Hilfesuchverhalten Betroffener“ zu beeinflussen und damit Prävention wirksamer zu machen. Wichtig sei dabei etwa eine differenzierte Medienarbeit, wobei die Autoren meinen, bereits einen positiven Trend in der Berichterstattung in den letzten Jahren erkennen zu können. Für Fachkräfte empfehlen sie, in der Arbeit mit Pädophilen problematische Mediendarstellungen kritisch zu hinterfragen, und sich gegebenenfalls selber für differenzierte Medienberichte als Ansprechpartner für Journalisten zur Verfügung zu stellen. Als positives Vorbild wird die Medienarbeit von Kein Täter Werden beschrieben.
Neben der Aufklärung der Gesellschaft wird auch die Sensibilisierung und Fortbildung von Fachkräften als wichtig genannt. Diese seien mit dem Thema Pädophilie sonst oft überfordert. Den Autoren zufolge brauche es außerdem einen „Risikoblick auf Einrichtungen der sozialen Arbeit“, womit sie meinen, dass nicht vergessen werden dürfe, dass manche Fachkräfte auch selber pädophil seien.
Als letzte Maßnahme der universellen Prävention nennen die Autoren wiederum die allgemeine Stärkung individueller Schutzfaktoren und Selbstregulationskompetenzen in der Gesellschaft, die bereits in Schulen und KiTas anfangen solle. Speziell bei Kindern und Jugendlichen, die später pädophile Präferenzen bei sich entdecken, solle dies als „Schutzfaktor gegen die Entwicklung sexuell grenzverletzenden Verhaltens“ wirken.
Kapitel 4: Selektive Prävention: Erkennen und Handeln
Selektive Prävention fokussiere sich den Autoren zufolge auf „Untergruppen, bei denen ein höheres Risiko besteht, dass sie Kinder sexuell missbrauchen oder durch ihre pädophile sexuelle Präferenz Leidensdruck ausbilden könnten“. Effektiv geht es in dem Kapitel am Ende vor allem darum, das Risiko zu reduzieren, das pädophile Menschen vermeintlich für Kinder darstellen würden.
Dazu beschrieben die Autoren zunächst genauer, welche Situationen sie als „Risikokontexte“ einordnen. Dabei gehen sie auf fünf Konstellationen genauer ein: Alleinerziehende Väter, männliche Betreuer in der Kinder- und Jugendhilfe, männliche Erzieher, ehrenamtlich mit Kindern arbeitende Männer sowie männliche Jugendliche mit jüngeren Geschwistern. Für jede Konstellation wird einzeln vorgerechnet, wie viele Männer in der jeweiligen Gruppe pädophil sein müssen; dies solle verdeutlichen, in welchem Umfang „die Gesellschaft mit der Problematik konfrontiert ist“. Zu jeder Konstellation gibt es ein illustrierendes Beispiel eines pädophilen Täters in dem jeweiligen Kontext. Um diese „Problematik“ bewältigen zu können, beschreiben die Autoren Maßnahmen und Schutzkonzepte, die Institutionen umsetzen sollten, wie zum Beispiel die Formulierung einer Selbstverpflichtungserklärung und systematische Fortbildungsangebote.
Für den Fall, dass Fachkräfte eine Pädophilie bei einem Mann im sozialen Umfeld eines Kindes vermuten, führen die Autoren die „Dissexualitäts-Checkliste“ als Screening-Instrument ein. Eine erste Checkliste soll dabei zunächst die Plausibilität von Straftaten gegen Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersgruppen einschätzen. Eine zweite Checkliste fragt ab, ob Zusatzinformationen wie eine „Selbsteinschätzung zur Präferenz“ oder Fremdberichte von Angehörigen oder Partner vorliegen, und ob der verdächtigte Mann bereit ist, sich einer Diagnostik zu unterziehen. Die dritte Checkliste fragt vorhandene Risikofaktoren ab, wobei ein sexuelles Interesse an Kindern als „besonders relevant“ bewertet wird. Die vierte und letzte Checkliste fragt schließlich analog Schutzfaktoren ab, mit der auch eine Pädophilie wieder relativiert werden könne. Anhand von vier Anwendungsbeispielen von männlichen Tätern, die als Väter in Familien mit Kindern leben wird die Anwendung dieser Checklisten exemplarisch vorgeführt, wobei die Autoren eine (vorläufige) Trennung der Väter von ihren Kindern genau in jenen Fällen empfehlen, in denen sie die Täter als pädophil einstufen.
Anschließend gehen die Autoren genauer auf das Thema des innerfamiliären Missbrauchs ein, wobei vier Kategorien von Risikofaktoren für diese Form der sexualisierten Gewalt beschrieben werden. Als sozioökologische Risikofaktoren listen die Autoren eine patriarchalische Familienstruktur, finanzielle Schwierigkeiten, soziale Isolation, aber auch einen ungezwungenen Umgang mit Nacktheit in der Familie, etwa wenn Vater und Tochter gemeinsam baden, auf. Weitere Faktoren betreffen die eigenen Kindheitserfahrungen, die wesentlich bestimmen würden, wie man sich selber als Vater verhält, wobei insbesondere Missbrauchserfahrungen und emotionale Vernachlässigung das Risiko für Missbrauch steigern würden. Als dritte Kategorie nennen die Autoren individuelle psychologische Eigenschaften, wozu etwa kognitive Verzerrungen und Impulsivität zählen. Darüber hinaus würden aber auch Inzestfantasien in Kombination mit Pädophilie das Missbrauchsrisiko „erheblich“ erhöhen. Als letzte Kategorie von Risikofaktoren werden Faktoren des Familiensystems gezählt, wozu unter anderem emotionale Abwesenheit der Mutter gehöre, die dazu führen könne, dass die Tochter vom Vater in die Rolle der Ehefrau gedrängt werde.
Am Ende des Kapitels geben die Autoren Handlungsempfehlungen für die Gesprächsführung bei Verdachtsfällen zum „Themenkreis Pädophilie“. Um Vertrauen aufzubauen, solle sich die das Gespräch führende Fachperson mit dem Thema Pädophilie auseinandergesetzt haben. Auch hier wird betont, dass die Auseinandersetzung mit Pädophilie und anderen möglichen „Präferenzbesonderheiten“ wichtig sei, weil man „nur dann Gefahrensituationen adäquat abschätzen kann“. In dem Gespräch solle auf mögliche kognitive Verzerrungen sowie darauf hingewiesen werden, dass bei Pädophilen die Gefahr für sexuelle Übergriffe auf Kinder besonders hoch sei. Gleichzeitig sollen Fachpersonen Verständnis für die Ängste Pädophiler vor Stigmatisierung zeigen, insbesondere die Angst davor, dass ihnen nach Eingestehen ihrer Pädophilie „sofort eine Gefährlichkeit für Kinder unterstellt wird“. Ein konfrontatives Vorgehen solle vermieden werden, um den Widerstand der Betroffenen nicht zu erhöhen und sie besser einer Diagnostik und (gegebenenfalls medikamentösen) Behandlung zuführen zu können. Für diejenigen, die unter ihren Präferenzen nicht leiden und deswegen keine Behandlung in Anspruch nehmen wollen, verweisen die Autoren darauf, dass es Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden sei, sie bei Straffälligkeit zu überführen.
Kapitel 5: Indikative Prävention: Behandlung und Unterstützung
Die letzte der drei vorgestellten Präventionsformen ist die indikative Prävention, die sich gezielt an Pädophile richten solle, die „frühe Anzeichen einer möglichen pädophilen Störung aufweisen“ oder diese bereits ausgebildet haben. Dabei müsse unterschiedlich vorgegangen werden, je nachdem, ob es sich um strafrechtlich im Hellfeld befindliche Täter handelt, oder um Menschen, die eigenmotiviert Hilfe suchen, ohne justizbekannt zu sein.
Im Hellfeld sei das Hauptziel bei der Begutachtung eines Täters vor allem festzustellen, ob bei ihm eine „abnorme sexuelle Neigung“ vorliegt. Dafür sollen sowohl die Umstände der Tat, als auch die sexuelle Vorgeschichte des Täters genau betrachtet werden. Dies sei einerseits wichtig, um die Schuldfähigkeit des Täters einzuschätzen, da eine besonders „schwere“ paraphile Störung unter Umständen zu verminderter Schuldfähigkeit führen könne. Andererseits sei dies auch für die Einschätzung des Rückfallrisikos relevant, die den Autoren zufolge insbesondere bei exklusiv Pädophilen „deutlich höher“ sei. Weiterhin listen die Autoren eine Reihe von Verfahren und Fragebögen zur besseren Einschätzung des Rückfallrisikos auf, die Aspekte wie eine möglicherweise vorliegende Psychopathie abfragen. Da Täter im Hellfeld außerdem oft von außen motiviert Therapieangebote aufsuchen würden, solle in probatorischen Sitzungen besonders darauf geachtet werden, dass sie Verantwortung für ihre Taten übernehmen und bereit sind, eigenmotiviert an sich zu arbeiten.
Bei Pädophilen im Dunkelfeld sei ebenfalls eine Diagnostik essenziell, „um zwischen pädophiler Präferenz und sexuellem Kindesmissbrauch ohne pädophile Präferenz zu unterscheiden“ und möglicherweise ebenfalls vorhandene psychische Störungen zu erkennen. Da Pädophile den Autoren zufolge „ein erhöhtes Risiko für sexuellen Kindesmissbrauch“ haben, müsse zu der Diagnostik auch immer eine Risikobewertung gehören, die Risiko- und Schutzfaktoren erfassen soll. Als Grundlage für die therapeutische Behandlung von Pädophilen stellen die Autoren schließlich die Berliner Dissexualitätstherapie (BEDIT) vor, die auch die theoretische Grundlage für die Therapie bei Kein Täter Werden bildet. Diese bestehe aus der Unterstützung der Selbstakzeptanz der Klienten, der Veränderung „problematischer Gedankenmuster und Verhaltensweisen“ sowie medikamentösen Behandlungsoptionen als Ergänzung, die besonders detailliert vorgestellt und nach Ansicht der Autoren „immer noch weitestgehend unterschätzt“ werden. Die therapeutische Grundhaltung solle dabei sexuelle Fantasien moralisch nicht bewerten, sondern nur grenzverletzendes Verhalten verurteilen, und den Klienten mit Respekt und einer „unbedingten positiven Wertschätzung der Person“ begegnen.
Auch bei „Risikosituationen“ solle der Therapierende offen und „ohne Verurteilung“ Bedenken benennen, um gemeinsam mit dem Klienten nach Lösungen zu suchen. Dazu listen die Autoren eine Reihe von Testverfahren auf, die zur „Identifizierung von Risikofaktoren im Zusammenhang mit pädophiler Sexualpräferenz“ dienen sollen. Dazu werden zum Beispiel „Einstellungen, die sexuelle Übergriffe rechtfertigen“ gezählt, aber auch ein Verlieben in Kinder, was als Indikator für eine als übermäßig gesehene „emotionale Kongruenz mit Kindern“ ein Risikofaktor für außerfamiliären Missbrauch sei. Reduktion dieser Risikofaktoren könne entsprechend den Autoren zufolge auch als Indikator für den Therapiefortschritt dienen.
Weiterhin wird der Ablauf der therapeutischen Nachsorge nach BEDIT-Handbuch beschrieben. Zentraler Bestandteil sei auch hier die „kontinuierliche Risikobewertung“, die Korrektur von kognitiven Verzerrungen, die Identifikation von Risikosituationen sowie die Überprüfung von „Selbstkontrollfähigkeiten bezüglich des Sexualverhaltens“. Zur Bewältigung von Risikosituationen stellen die Autoren einige Strategien vor, wie etwa das „sofortige Verlassen gefährlicher Situationen“ und der Aufbau eines individuellen Notfallplans, der auch in Rollenspielen geprobt werden solle.
Als Ergänzung zu einer Therapie erwähnen die Autoren erstmals auch die Selbsthilfe. Diese spiele eine wichtige Rolle, da sie Betroffene aus der sozialen Isolation befreie, Austausch und Unterstützung ermögliche und außerdem eine Brücke zu einer Therapie sein könne. Gleichzeitig warnen die Autoren, dass es im Internet auch „problematische Foren“ gäbe, insbesondere solche, die „sexuelle Kontakte zu Kindern verharmlosen“, dadurch „kognitive Verzerrungen verstärken“ und ultimativ das „Risiko für sexuelle Übergriffe erhöhen“. Als „prosoziale“ Selbsthilfegemeinschaften empfehlen die Autoren die Foren Gemeinsam statt allein und Virtuous Pedophiles.
Zuletzt gehen die Autoren auf die Behandlung pädophiler Jugendlicher ein und stellen Aspekte des BEDIT-A vor, einer Version des BEDIT-Handbuchs speziell für Jugendliche. Bei Jugendlichen stehe anders als bei Erwachsenen weniger die Rückfallprävention, und mehr die Integration der Pädophilie in das Selbstbild im Vordergrund. Zudem gäbe es regelmäßige Gespräche mit den Eltern, um durch soziale Kontrolle „Risikofaktoren zu reduzieren“. Medikamentöse Behandlung wird bei Jugendlichen nicht ausgeschlossen, erfordere aber eine „besonders sorgfältige Abwägung der Risiken für die körperliche Entwicklung“. Als „unsichtbare Hochrisikogruppe“ werden außerdem pädophile Jugendliche mit Intelligenzminderung genannt. Für diese Gruppe brauche es Spezialeinrichtungen im Sinne der kürzlich gescheiterten Wohngruppe in der Uckermark, in der diese Jugendlichen von Kindern ferngehalten und dauerhaft durch speziell geschulte Fachkräfte betreut und überwacht werden können.
Kapitel 6: Vernetzung und Qualitätssicherung
Im letzten Kapitel fokussieren sich die Autoren auf den Aufbau von Netzwerken von Fachkräften sowie der Qualitätssicherung bei Behandlungsmaßnahmen für Pädophile. Die (interdisziplinäre) Vernetzung von Fachkräften sei dabei wichtig, um multidimensionale Lösungsansätze zu realisieren, potenzielle Problemlagen frühzeitig zu erkennen und die „hohe emotionale Belastung“ von Fachkräften abzufedern. Damit solle letztendlich die bestmögliche Unterstützung für Betroffene und ein „effektiven Kinderschutz“ realisiert werden. Die Autoren listen eine Reihe möglicher Kooperationspartner auf, die bei der Netzwerkarbeit hilfreich sein können, wobei ausschließlich Kinderschutzorganisationen und Organisationen zur Prävention sexualisierter Gewalt genannt werden. Zudem geben die Autoren Tipps für Sozialarbeiter für das Vorgehen bei einem Verdacht auf Kindesmissbrauch.
Kapitel 7: Anhang
Im Anhang befinden sich zunächst einige Informationstexte, die als eine Art Handout für verschiedene Zielgruppen gedacht sind. Ein Text appelliert an die Allgemeinheit gegen die Ausgrenzung und Stigmatisierung Pädophiler, da dies einerseits „grundsätzlich inhuman“ sei, aber vor allem auch die sexuelle Traumatisierung von Kindern durch Pädophile wahrscheinlicher mache. Ein zweiter Aufklärungstext ist an Angehörige pädophiler Menschen gerichtet und appelliert dazu, als nicht-verurteilende Vertrauensperson daran mitzuarbeiten, dass „eine passende Lösung gefunden wird“, womit insbesondere die Inanspruchnahme einer Therapie inklusive eventueller medikamentöser Behandlung gemeint ist. Bei Kindern im Umfeld des Pädophilen sei außerdem eine „fundierte Gefahrenanalyse“ unbedingt erforderlich, die „Grundlage für gegebenenfalls notwendige Maßnahmen wäre“. Ein letzter Infotext richtet sich schließlich direkt an pädophile Männer (oder solche, die befürchten, pädophil sein zu können). Die zentrale Botschaft ist hier, dass sich „niemand seine sexuelle Präferenzstruktur aussucht“ und gegen reine Fantasien „nichts einzuwenden“ sei, aber jeder für seine Taten verantwortlich ist. Dazu gehöre auch, die „unliebsamen Anteile“ der eigenen Sexualpräferenz nicht auszublenden, sondern sich ihnen zu stellen. Der pädophile Leser wird zudem dazu ermutigt, sich gegenüber Vertrauenspersonen zu outen, da dies laut „klinischer Erfahrung in hohem Maße stabilisierend“ sei. Auch dieser Text bewirbt Therapien und Medikamente und fordert eine „Gefahrenanalyse“ bei Kindern im Umfeld.
Weiterhin listen die Autoren eine Reihe von Anlaufstellen auf, wobei auch hier Anlaufstellen zur Kriminalprävention, zu Kinderschutz und sexualisierter Gewalt thematisch überwiegen. Abschließend gibt es einige Informationsblätter zum Begriff der Dissexualität sowie zu triebdämpfenden Medikamenten, denen drei (ausschließlich positive) Erfahrungsberichte angehängt sind.
Schlussworte
Auch wenn „Pädophilie behandeln“ auf dem Cover steht, geht es in dem Buch also überwiegend um Prävention von und Umgang mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Am Ende habe ich mich vor allem gefragt, für wen das Buch eigentlich geschrieben ist: für Helfende, die mit Pädophilen arbeiten, oder solchen, die mit Verdachtsfällen für sexualisierte Gewalt gegen Kinder konfrontiert werden?
In ersteren Fall ist die Reduktion der Behandlung Pädophiler auf das Thema Kriminalprävention problematisch. Therapeuten und Sozialarbeiter, die nicht in Projekte wie Kein Täter Werden eingebunden sind, werden ja gerade auch von Pädophilen aufgesucht, die sich von Kein Täter Werden eben deshalb nicht angesprochen fühlen, weil das potenzielle Begehen von Straftaten kein Problem für sie darstellt. Das Buch vermittelt Fachkräften nun den Eindruck, auch in solchen Fällen seien sie dafür verantwortlich sicherzustellen, dass es nicht zu Straftaten kommt. Der oft vorhandene Leidensdruck bei Pädophilen selber, zum Beispiel ausgelöst durch gesellschaftliche Ausgrenzung, wird zwar öfter mal erwähnt, aber meist auch in dem Kontext, dass ein erhöhter Leidensdruck letztendlich vor allem Straftaten wahrscheinlicher mache. Die Autoren scheinen das Interesse an Pädophilen und deren Schicksal zu verlieren, sobald die oft genannte „Verhaltenskontrolle“ aus ihrer Sicht erreicht ist.
Aber auch im letzteren Fall ist die Reduzierung des Themas „Kinderschutz“ auf „Schutz von Kindern vor Pädophilen“ problematisch, da es den Blick auf nicht-pädophile Täter trübt, die laut Aussage der Autoren selber die Mehrheit der Kindesmissbrauchstäter darstellen. Dazu entstand bei mir teilweise den Eindruck, als bewerten sie sexualisierte Gewalt durch Täter, die nicht pädophil sind, als weniger schlimm.
In jedem Fall erreicht das Buch eines: Pädophile als gefährlich darzustellen, als potenzielle Täter und als Risiko, das man „managen“ müsse, und stellt dabei Pädophile grundsätzlich unter Generalverdacht. Diese und weitere problematische Aspekte des Buches werde ich in Teil 2 dieser Serie genauer betrachten.